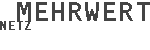
Bachstraße 26, D-52066 Aachen
e-mail eco@recorder.westend.com



Pressespiegel
Positionen 31, Mai 1997, Berlin
Zu einem WWW-Projekt von Norbert Walter Peters
Der Mythos Internet erzählt von der Eroberung eines neuen Territoriums, das durch seine Staatsferne, Kulturnähe und Geistsättigung glänzt. In diesem Neuland, so glauben viele Cyberspaceianer, geht es um politische Emanzipation, Kultur für alle und um geistige Freiheit. Doch nach ihrer feierlichen Hochzeit vor Jahren verbringen Multimedia-Computer und Telefon ihre Flitterwochen nun allzulang schon in Utopia. Jedenfalls ist der erste Hype vorüber: Überzogene Erwartungen werden revidiert, der Mythos Internet wird dekonstruiert. So gilt der Blick verstärkt den realistischen Chancen und Risiken der Netzwelten.
Neuartige Chancen bietet das World Wide Web (WWW) etwa den Künsten. So wird das WWW zum virtuellen Präsentationsraum für das 'Elektronische Bauhaus' (Jürgen Claus). Aber eine Weile wird die Gleichstellung der Künste im Internet noch dauern, denn noch überwiegen eindeutig die Text- und Bilddarstellungen. Filmisches beschränkt sich auf einfache Animationen und stotternde Videosequenzen. Klänge finden sich derzeit noch selten. Digitale Textkonvolute und Museen, wie etwa das REIFF-II als eines der ältesten Exemplare, sind eben früher und zahlreicher im Internet aufgetaucht als virtuelle Philharmonien. Das hat im wesentlichen mit der technischen Entwicklung zu tun, dauerte doch das Herunterladen von Sounddateien bis vor kurzem fünfmal länger als die Spielzeit selbst. Erst mit Programmen wie etwa "RealAudio", die vor ein paar Monaten eingeführt wurden, können konventionelle Multimediarechner über schnelle Leitungen Klangereignisse in Echtzeit wiedergeben.
Als Beispiel dafür, wie Musikkünstler den Multimediabereich des Internet derzeit für ihre Ideen nutzen, sei das Projekt Mwavaaz vorgestellt, das Norbert Walter Peters in Zusammenarbeit mit dem Aachener Kunstverein Mehrwert im Internet zu realisieren begonnen hat. Norbert Walter Peters ist bildender Künstler und Musiker zugleich. Der Tradition nach arbeitet er auf dem Feld von Intermedia und Geräuschkunst, von Mixed Media und ephemerer Kunst. Wichtig sind ihm kombinatorische Verfahren, etwa die Zusammenbindung verschiedener Kunstbereiche. Eine große Rolle spielt die Permutation, also die Vertauschung von Elementen innerhalb einer Kette. Bei seiner Ideenfindung beginnt Peters zwar mit bildhaften Angelegenheiten, mit literarischen Motiven und Metaphern vor allem, dann aber wechselt er rasch in den Bereich des Kalküls. Insofern ist Peters ganz Musiker: Die narrativen Ordnungen der literarische Themen und Motive werden aufgesprengt und mithilfe von kompositorischen Verfahren, wie Kombination und Permutation, in neue Ordnungen übersetzt.
Im Fall von "Mwavaaz" besteht der kombinatorische Kunstgriff in der Verbindung von Musik, Grafik und Installation. "Mwavaaz" ist eine Werk-Trilogie, zusammengesetzt aus einem Musikstück, einer grafischen Arbeit auf Papier und einer Klanginstallation. Das dreiteilige Werk ist zunächst unabhängig vom Internet erdacht und realisiert worden. Das Musikstück, verwirklicht als eine Reihe von Tonbandaufnahmen, kombiniert seinerseits gesungene und gesprochene Texte von Hildegard von Bingen und Paul Cezanne, instrumentale Musik sowie Geräusche aus Umwelt und Natur. In der Grafik, bezeichnet als "Imaginäre Partitur", sieht man eine Handzeichnung geometrischer Gebilde, die als Flächenteilungen proportionale Verhältnisse repräsentieren, wie sie auch in der Musik begegnen. Analog zu den Naturgeräuschen im Musikstück findet sich in der Grafik eine mit Naturfarbe colorierte Zone: An proportional ausgezeichneter Stelle setzt verriebener Rost einen rötlichen Akzent. Der dritte Teil von "Mwavaaz" schließlich ist die Klanginstallation, die sich noch im Status der Projektierung befindet. Gedacht ist an eine Verbindung aus Installation und Toninszenierung innerhalb und außerhalb eines Ausstellungsraums. Ein Lichtstrahler sowie ein mit Buntglas und Seide versehenes Fenster erzeugen zusammen mit dem Wechsel natürlichen Lichts ein prozessuales Ereignis aus Licht, Farbe und Raum. Über vier Kassettenrekorder sind subliminale Töne zu hören: Geräusche, Stimmengemurmel und mittelalterliche Gesänge. Die geflüsterten und gesungenen Texte handeln von der legendären Liebesgeschichte zwischen Abaelard und Heloise zu Beginn des 12. Jahrhunderts.
Im Sommer 1996 ergiff Norbert Walter Peters die Möglichkeit, alle drei Werkteile auf WWW-Seiten zu präsentieren. Das Web-Design lieferte Christian Scholz, einer der Informatiker bei Mehrwert. Über elf HTML-Seiten mit eingebundenen Bild- und Sounddateien zeigen sich die Werkteile in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Partitur-Ausschnitte verknüpfen sich mit Soundbeispielen, computergenerierte Textbilder treffen auf das reproduzierte grafische Blatt "Imaginäre Partitur", und Erläuterungstexte verbinden sich mit der Planskizze der Klanginstallation. Die Vorläufigkeit ist Programm, alles verharrt im Status des Unabgeschlossenen. Es entsteht ein 'offenes Kunstwerk' (Umberto Eco), mithin ein Werk "under construction", wie es im WWW so häufig heißt.
Wenn einmal der Generalschlüssel gefunden ist, wird das Werk "Mwavaaz" von allen Seiten her zugänglich. Zum Passepartout wird zunächst die spezielle Kombinatorik, dann auch die Permutation, und meistens sind es beide Verfahren zusammen. Weniger die Ergebnisse eines einmaligen Tauschvorgangs stehen dabei im Vordergrund, als vielmehr das Tauschen selbst. Das Verfahren erinnert an die praktische Kabbala, an die Methoden der Gematria, bei der verschiedene Wörter des Hebräischen über ihre identischen Zahlenwerte verknüpft werden, um "verborgene" semantische Bezüge zu entdecken. Peters kombiniert diese kabbalistische Art der Buchstaben / Zahlen-Verkettung mit der anagrammatischen Vertauschung von Buchstaben. Ein Name verwandelt sich in einen Zahlenwert und zusammen mit den Notenwerten der Buchstaben des Anagramms in eine Klangfolge. Wichtig dabei sind die dadurch konstruierten Ähnlichkeitsbeziehungen. So etwa können zwei Namen über die identischen Quersummen der Zahlenwerte ihrer Buchstaben, durch ihre anagrammatischen Beziehungen oder aber durch klangliche Eigenschaften der entsprechenden Tonfolgen geheimnisvoll aufeinander verweisen.
Die Permutationen streben potentiell gegen Unendlich. Das wußte die Moderne bereits seit Ferdinand de Saussure, der als Linguist Anfang des Jahrhunderts antike Gedichte als Anagramme, als geheime Verkörperungen von Heroen- und Götternamen systematisch mißverstand und an der unendlichen Zeichenbildung schier verzweifelte. In Peters Kunst des Anagramms wird dieser Zauber ästhetisch gebannt. Zwar kommen namentlich genügend Heroen aus Kunst, Musik und Literatur vor, doch im Licht der endlosen Permutationen und medialen Wechselspiele zerbirst der Musentempel in zahllose Fragmente. Solche Zeichensplitter werden ihrerseits wieder in die Kombinations- und Permutationsmaschine eingespeist, um sich in anderen Ordnungssystemen neu zusammenzufügen. Peters kombiniert die Anagramme sogar mit Farbsystemen, geometrischen Ordnungen und astronomischen Korrelationen.
Gebremst wird diese toll gewordene Interpretation in "Mwavaaz" für einen Moment durch die narrative Ordnung der mittelalterlichen Liebesgeschichte. Näher besehen ist die Geschichte zwischen Heloise und Abaelard allerdings ebenso mehrdeutig wie ein Buchstabe, eine Zahl oder ein Satz. Die mittelalterliche Allegorese machte aus Heloise die unerlöste Seele, die zur Weisheit strebt, verkörpert durch Abaelard. Der Philosoph des Nominalismus wiederum vertrat die Auffassung, daß die Wörter außerhalb ihrer Stellung im Satz nur mehrdeutige Zeichen sind. Hier löst sich die narrative Ordnung wieder auf, die mittelalterliche Story illustriert die moderne Einsicht in die Endlosigkeit aller Zeichenprozesse, und "Mwavaaz" gestaltet solche Erkenntnis im Internet schließlich als virtuelle Performance.
Es ist wie beim Surfen im Internet: Während des endlosen Vertauschens von Bildschirmseiten, Oberflächen, Medien und Zeichen tauchen zuweilen geheimnisvolle Ordnungen auf, die ebenso schnell verschwinden wie sie entstehen. Schon in der Kabbala konnte das Erleben flüchtiger Ordnungen während der kognitiven Datenverarbeitung in ekstatische Zustände führen. Das Surfen im Netz, wie es der Mythos Internet will, ist nicht weit von solcher wundergläubigen Praxis entfernt.
Christian Bracht
Dank an den Kulturserver heimat.de und den Provider Westend GbR für den Zugang zum Netz
Text: Christian Bracht, Gestaltung: 2w