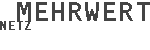
Bachstraße 26, D-52066 Aachen
Tel/Fax ++49-241-536597
e-mail eco@recorder.westend.com



Digitale Museen
Gregor Jansen
Student der Kunstgeschichte,
RWTH Aachen
Museen im Internet
"Je stärker differenziert und pluralisiert wird, desto wichtiger werden Oberflächen." (Norbert Bolz)
Computer und MuseenDaß in Museen Computer stehen, und man sich nicht gerade in einem Museum für ebensolche befindet, verwundert heute wohl keinen mehr. Ich erinnere mich aber an die Tizian-Ausstellung in Venedig 1990, in der zahlreiche interaktive Computer postiert waren, die Hinweise auf Provenienz, Vergleichswerke und Restaurierungsergebnisse gaben. Dies wurde damals in der Fachpresse kontrovers diskutiert - die Rechner standen teilweise direkt neben und mithin für viele "zu nah" an den Werken.
Es sind museumspädogische Aspekte, die allzu häufig die Anwendung bestimmen, bspw. auch bei der Stefan Lochner Ausstellung im Wallraf-Richartz-Museum, Köln 1993 - wo die Computer (besser Screens) im neutralen Bereich des Foyers und mithin in einer neutralen Pufferzone standen, in der nach Kritikermeinung durchaus experimentiert werden darf. In beiden Fällen waren Ergebnisse, die auch im Katalog konventionell sichtbar waren, per Touch-Screen abfragbar und ergaben ein neues Bild, einen neuen didaktischen Umgang mit wissenschaftlichem/historischem Material.
Hinter den öffentlichen Ausstellungsräumen, in den Büros und Depots der Museen stehen aber weit mehr Computer als davor, ersetzt diese Maschine doch mehr und mehr die Zettelkästen der Archive und der Bestände mit häufig mehreren tausend Positionen. Auch am hiesigen Suermondt-Ludwig-Museum wird seit zwei Jahren auf Computerisierung im Bestand umgestellt. Leider nur konventionell in Buchform und Abbildungen, mit der Digitalisierung und Netzeinspeisung tut man sich schwer. Dabei sind die internationalen Katalogisierungsvorgaben für solche Projekte längst erschienen - federführend ist hierbei der niederländische Iconclass und das deutsche MIDAS.
World Wide WebDie bei diesen Arbeiten entstehenden Dateien (und Abbildungen) lassen sich dank der www-Technik mühelos (nicht zu vergessen, daß das natürlich alles Geld kostet) in das Netz transferieren. Ein nicht nur für Wissenschaftler interessanter Weg in die Zukunft. Heute sieht es aber meist so aus, daß die Mehrzahl der rund 2300 Museen im Netz nur eine Home-page mit ihren allgemeinen Daten und Öffnungszeiten anbieten. Wenige offerieren ihre Kataloge (die ja ebenfalls meist auf Diskette an die Verlage gehen), Künstlerprojekte oder weitere Verweise an (die sogenannten Links). Neben der (unbegründeteten, wie Untersuchungen ergaben) Angst vor fernbleibendem Publikum oder geringen Buchabsätzen, bestimmt ein konservativer Mißtrauensüberschuß in den Direktorenzimmern den Umgang mit der Technik. Ein fortschrittlich zu nennendes Angebot bietet das Deutsche Historische Museum Berlin, welches neben Ausstellungen, Publikationen, usw. die Demonstration am 4.November 1989 präsentiert und sogar eine mailbox zu musealen Problemstellungen integriert hat. Hier findet sich eine ausführliche Museenliste nicht nur für Berlin.
Aus der Pionierphase des 3W-Netzes kommen die virtuellen Museen wie das in Aachen entstandene ReiffII, welches in der Links-Liste des DHM unter deutschen Museen zu finden ist, doch gehört es zu den virtuellen Museen, die in einem Rechner an irgendeinem Ort der Welt ihren Bestand verwalten.
Diese Form der Kunstpräsentation ist selbstverständlich reizvoll, da es die "medialen" Künstler selbst sind, die ihre Werke den Kuratoren anbieten und den Weg in die Öffentlichkeit antreten. Ihre Relevanz ist jedoch bislang eher gering, da sehr schlecht eine Infrastruktur in Form des Kunstmarktes oder personeller Öffentlichkeit hergestellt werden kann. Die realen Museen plagen ganz andere Sorgen: Das San Diego Art Museum hat die Präsentation ihres zeitgenössischen Kunstbestands im web aufgegeben, da u.a. Frank Stella und David Hockney die Einwilligung zur digitalen Verbreitung ihrer Werke nicht gaben. Urheberrechts- und Copyrightfragen sind ein weiterer Punkt in der Verunklärung der Situation. Angemerkt sei, daß sich web-Seiten und Bilder durchaus schützen lassen. Corbis <http://www.corbis.com/>, das von Bill Gates gekaufte Bettmann-Archiv, liefert bspw. seine Bilder nur mit elektronischem Wasserzeichen versehen an die Klientel der Kunden aus (es sei denn, man zahlt das übliche Verwertungshonorar).
Der konservative (und wirtschaftlich raffinierte) Vatikan zeigt sich als ein privatinitiiertes Projekt von seiner besten Seite im Netz, da nicht nur Bibeltexte oder Papstbriefe abfragbar sind, sondern die gesamte Sixtinische Kapelle (325 Bilder), die Raphael Stanzen (266 Bilder) oder die Vatikanischen Museen (596 Bilder) - Probleme mit dem Urheberrecht sind hierbei weniger problematisch.
Zum Abschluß sei das Dia Center for the Arts in New York vorgestellt, welches Vorbildcharakter aufweist. Mit seinem kompletten Angebot und Hintergründen im web ganz dem Namen Dia=durch verpflichtet, findet man Sinn stiftende Künstlerprojekte: Komar & Melamid (The Most Wanted Paintings), Tony Oursler (Fantastic Prayers). Das Dia ist eines der ersten Ausstellungsinstitute, das die Möglichkeiten des Mediums in Zusammenarbeit mit Künstlern seit Jahren unter Beweis stellt. Möglicherweise liegt es daran, daß es sich mit Sara Tucker einen Director of Digital Media leistet. Meines Wissens ist so etwas selbst an Kunst- oder Medienhochschulen in unserem Lande (noch) nicht die Regel - geschweige an öffentlichen Kunsthäusern. Vielleicht zeigen die privat-finanzierten, Galerien bspw. oder das Getty Grant Projekt, was machbar ist. Vielleicht aber auch das von Michael Krome betreute artworks-Projekt für den "Medienstandort" NRW.
Bolz-Zitat ausLiteraturtip: Michael Fehr, u.a. (Hg.), Platons Höhle. Das Museum und die elektronischen Medien, Wienand Verlag Köln 1995: S. 160.
Koordinator: Gregor Jansen
Diese Veranstaltung mit freundlicher Unterstützung durch:
Kulturinitiative Raststätte
Text: Gregor Jansen, Gestaltung: 2w