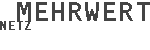
Bachstraße 26, D-52066 Aachen
Tel/Fax ++49-241-536597
e-mail eco@recorder.westend.com



Privatsphäre
Kunsthistoriker
FH Aachen
Sprachkultur und Bildkultur im Netz
Ein kleiner Nachtrag zur Romantik-These:
"Was ist am Netz so attraktiv?"
Ich bekam natürlich wieder einmal alles viel zu spät mit. Plötzlich, innerhalb eines halben Jahres, waren Leute an Informationen interessiert, für die sie sich vor kurzem nicht einmal umgedreht hätten. Zumindest gaben sie vor, sich für solche Informationen zu interessieren. Meist von sehr jungen Leuten wurde in diesem Zusammenhang die alte Weisheit ausgekramt "Wissen ist Macht". An dieser Weisheit ist, wie es mit alten Weisheiten nun mal so ist, nur die Hälfte wahr. Eine einzige Tageszeitung bietet mehr Informationen, als ein Mensch am Tag wahrnehmen, geschweige denn verarbeiten kann (deswegen behaupte ich zumindest, überhaupt keine Zeitungen zu lesen). Die Tageszeitung führt dann auch genau zu einer Antwort auf die Frage, wie es zur Faszination angesichts der angeblich erst mit dem Netz zur Verfügung stehenden Daten kommen konnte. Die Antwort wird nicht unwidersprochen bleiben, aber ich will sie trotzdem geben: Jeder kann sich Zeitungen und Zeitschriften die Menge besorgen, ohne dafür Unsummen ausgeben zu müssen. Jeder kann zusätzlich in Deutschland durch 5-20 Fernsehkanäle zappeln und hoffen, daß "Informationen" dabei sind, aber: Millionen von Internet-Nutzern wähnen sich im exclusiven Besitz eines nur ihnen bekannten Schlüssels zum Sesam-öffene-Dich halbgeheimer Datenbanken. Das Tuscheln über Veröffentlichungen und Listen, die man aufgestöbert habe und nur sehr guten Freunden weitergebe, sprach natürlich der behaupteten demokratischen, ja sogar demokratisierenden Tendenz der Netzkultur hohn. Der exclusive Charakter drückte sich im Internet selbst vor allem in zwei Dingen aus, in einer unbeholfenen Sprache und einem unbeholfenen Design.
Erfolgsgeheimnis: unbeholfenes Design.Das Geheimnis des Internet-Erfolgs liegt in der teilweise am unbeholfenen, unnötig aufgedrehten Design der meisten Seiten. Man sieht ihnen an, daß ihre Gestalter alles, wirklich alles zeigen möchten, was sie gerade gelernt haben. Metallisch schimmernde Schattierungen, wohin man schaut. Die Manie, alles und jedes zu schattieren, hat sich auch unmittelbar in den gedruckten Medien breitgemacht. Symbolische Tastaturen, Knöpfe, die zu drücken sind, Schalter, die signalisieren: hier geht's um Netzthemen, hier kann man selbst was machen, jetzt wird's interaktiv. (Beispiele WIRED 3/95, S. 48, SPIEGEL-Titel 11/96, The Times-Beilage "Interface") Besonders gern werden Schriften schattiert. Ich wage mir nicht auszumalen, wie sich Immanuel Kant über solche Moden echauffiert hätte. Der Philosoph empfand schon die Verwendung der lateinischen Schrift statt der deutschen als Zumutung. Ganz unerträglich wurde es für ihn, wenn diese dann auch noch mit "Ditoschen Lettern" statt mit Breitkopfschen gesetzt wurde und das, der Gipfel buchdruckerischer Unverschämtheit, nicht mit schwarzer, sondern mit grauer Tinte. Pfui Deibel! Auf diese Weise würde sich der Philosoph nicht gewundert haben, wenn bald gesundheitliche Schäden beim lesenden Publikum eingetreten wären, "so wie in Marokko durch weiße Übertünchung aller Häuser ein großer Theil der Einwohner der Stadt blind ist..."1
Der Untergang des Abendlandes ist eben kaum noch aufzuhalten; und das seit wenigstens 200, wahrscheinlich aber schon seit 2000 Jahren.
Das Geheimnis des Internet-Erfolgs liegt teilweise auch an der unbeholfenen Sprache, mit der man auf den Netz-Seiten konfrontiert wird. Die meist nur schwach redigierten Texte versprechen gerade wegen ihres unbeholfenen Duktus, gerade wegen der massenhaft auftretenden Schreibfehler Authentizität. Ein bestimmter Sprachstil, der den Jugendsprachen nahesteht verstärkt das Insider-Gefühl. Die Zeitschrift "wired" hat bereits einen "Jargon Watch" eingerichtet. Beispiel: cu für "see you". Nach demselben Prinzip arbeiten die EMOTICONS, die das Gegenteil des oben beschriebenen aufgepeppten Designs darstellen. Zeichen, zusammengesetzt aus Zeichen, die Gefühle und Stimmungen zum Ausdruck bringen sollen. Zuerst nur in hermetischen Zirkeln verwendet, sind sie mittlerweile zum Markenzeichen der VEBACOM aufgestiegen.
Daß im Internet, speziell in unzähligen Mails eine ebenso undeutliche, wie unschöne Sprache gesprochen werde, findet auch Clifford Stoll (soeben erschienen das kulturpessimistische Buch: Die Wüste Internet. Geisterfahrten auf der Datenautobahn, Frankfurt a.M. 1996.) Was er vor allem bemängelt, sind "undurchdachte Argumente", wie sie bei nicht redaktionell betreuten Texten zwangsläufig auftauchen müssen. Die meisten Texte sind so zu lesen, wie sie sich ein einzelner Mensch ausgedacht und in die Tastatur gehämmert hat. Nur sehr selten und untypisch für Netzveröffentlichungen ist der Filter zumindest einer zweiten Person, die diesen Text liest, bevor er der Öffentlichkeit zugemutet wird.
Publikationen im Netz kosten den Autor (anders, als z.B. in den Naturwissenschaften üblich) keinen Pfennig. Das führt dazu, daß Autoren glauben, alles, was sie sich einmal ausgedacht haben, müsse zwangsläufig auch anderen mitgeteilt werden. Es scheint einen unmittelbaren Zusammenhang zu geben zwischen den Faktoren Keine Kosten, Kein Bemühen, Keine Filterung und Keine Qualität. Der Austausch wissenschaftlicher Überlegungen sinkt damit auf das Niveau von Stammtischgesprächen. Das Wichtigste: Ernsthafte Argumente werden nicht dem Netz anvertraut.
Hinzu kommt ein Zweites: Für die Publikation im Netz ist vorläufig und auch in absehbarer Zeit kein Honorar zu erwarten. Auch das motiviert nicht gerade zu intellektuellen Höchstleistungen.
Drittens: Das Konsumieren des Netz-Angebots ist für einen großen Teil der Nutzer kostenlos, weil es durch die Universitäten angeboten wird. Den Stellenwert, den diese kostenlosen Informationen haben, ordnen Leser automatisch beim Niveau von Werbezeitungen (Aachener Woche) oder Kaufladenillustrierten ein (Bäckerblume, Die kluge Hausfrau). Keinem der engagierten Internet-Projekte will ich damit mangelndes Niveau unterstellen, schon gar nicht die Verdienste der "Bäckerblume" bei der täglichen Lebensbewältigung schmälern. Ich vermute aber, daß es schwierig werden wird, in Netz-Veröffentlichungen weit über dieses Niveau hinauszukommen. Das liegt auch daran, daß die Leserschaft der jeweiligen Veröffentlichungen sich auf eine Person, nämlich die des Autors verringern könnte. Das Massenmedium schafft durch ein massenhaftes Angebot eine Situation ausgeglichener Nachfrage: ein Anbieter, ein Empfänger. Schon jetzt macht sich in der Sprache eine Intimität bemerkbar, nach der man vermuten könnte, die Autoren schrieben vorwiegend für sich selbst. Daß die e-mail-Sprache der gesprochenen näherstehe, als der geschriebenen, hatte Nicolas Negroponte 1995 schon bemerkt, allerdings bei aller Spekulationsfreude keinen Grund dafür angegeben. Trotzdem spekulierte er, e-mail werde der dominierende Weg zwischenmenschlicher Kommunikation werden.2 Ich glaube, es ist nicht nötig, ihm ausdrücklich zu widersprechen. Über diese Entwicklungen zu reden, ist nicht so schlimm. Über diese Entwicklungen zu schreiben, ist gefährlicher. Es scheint ja zumindest so, daß fast alles, was noch vor 3-5 Jahren die Grundlage einer Diskussion über Technik war, heute weit überholt sei. Dazu gehören Mega- und Gigabites an Speicherkapazität, die noch vor 10 Jahren als völlig utopisch galten. Das verschafft den Romantikern die Grundlage für die Projektion ihrer "möglichen Welten" (ich sprach darüber) zum Beispiel Nicolas Negroponte die Möglichkeit, über wandgroße Bildschirme, Sensoren an allen Körperteilen, Toastbräune- und Milchverbrauchscomputer zu spekulieren.3
Was noch vor zehn Jahren über eine technische Entwicklung geschrieben wurde, die unausweichlich eintreten werde, ist heute sehr sehr peinlich zu lesen. Entweder war es nicht kühn genug oder es war zu kühn. Das "Atomkraftwerk im Vorgarten" wurde auch (zum Glück) nicht verwirklicht. Die Welt hat sich trotzdem stark verändert, wenn auch in völlig anderen Bereichen, als man noch vor 15 Jahren vermutete.
2) <http://www.bwk.tue.nl/lava/forum/books/negroponte.html> Nicolas Negroponte, Being digital, New York 1996 (zuerst 1995), S. 191.
3) <http://www.bwk.tue.nl/lava/forum/books/negroponte.html> Nicolas Negroponte, Being digital, New York 1996 (zuerst 1995), S. 100.
Koordinator: Gregor Jansen
Diese Veranstaltung mit freundlicher Unterstützung durch:
Kulturinitiative Raststätte
Text: Ludger Fischer, Gestaltung: 2w